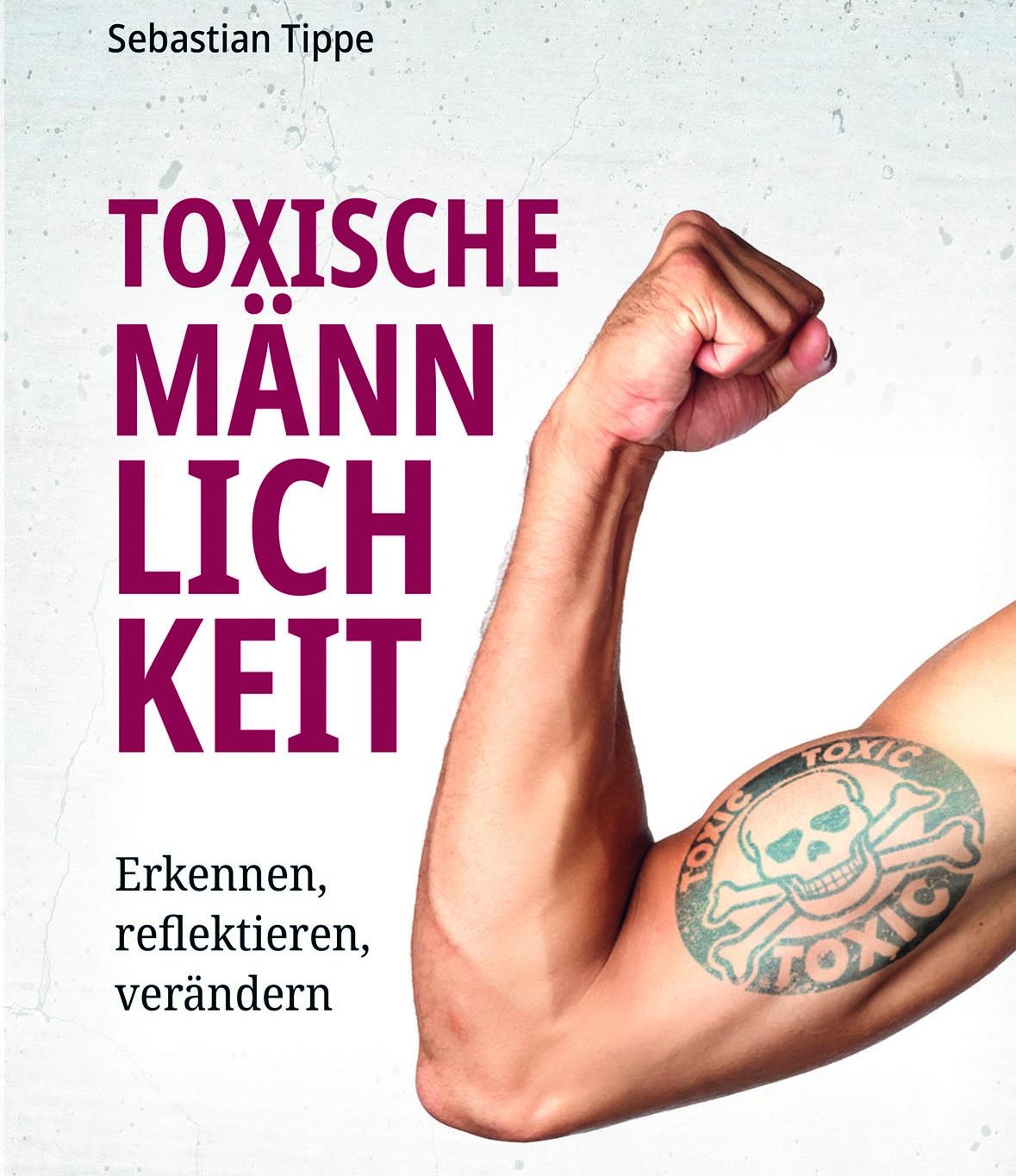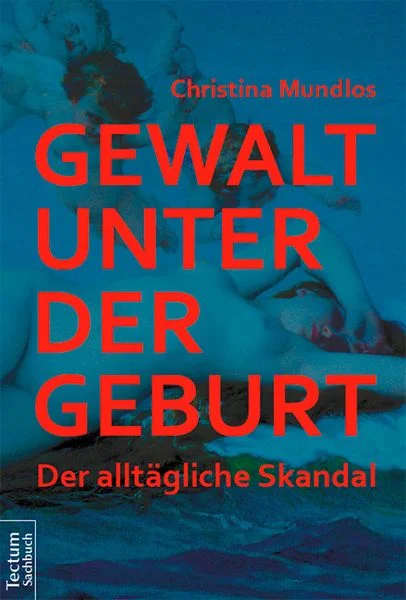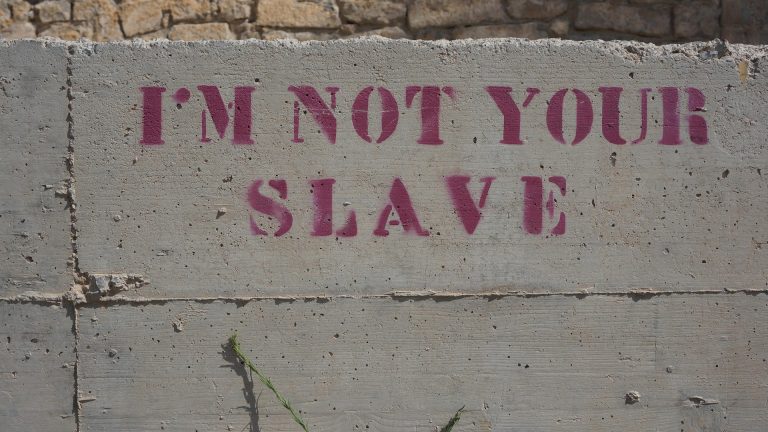Gewalt unter der Geburt: Wo sind eigentlich die Väter?
Im Jahr 2015 erschien das Buch „Gewalt unter der Geburt: Der alltägliche Skandal“ der Soziologin, Feministin und Autorin Christina Mundlos. Es wurde erstmals die strukturelle Gewalt an Frauen durch geburtshilfliches Personal öffentlich thematisiert und endtabuisiert. Seitdem hat Christina Mundlos zahlreiche Fachartikel zu dem Thema veröffentlicht, Radio- und Fernsehinterviews gegeben, Workshops durchgeführt und Vorträge gehalten um auf die katastrophale Situation in der Geburtshilfe hinzuweisen.
Warum dies so ist und was getan werden muss damit Väter sich aktiv beteiligen um ihre Partnerin und das Baby unter der Geburt zu schützen und zu unterstützen, möchte ich in dem vorliegenden Beitrag erläutern.
Definition von Gewalt unter der Geburt
Christina Mundlos teilt den Begriff „Gewalt“ in zwei Kategorien ein: psychische und körperliche Gewalt.
Zur psychischen Gewalt gehört, dass Frauen unter der Geburt angeschrien, ausgelacht, beschimpft und beleidigt werden. Sie werden nicht ernst genommen, sie werden schikaniert, bedroht, erpresst und eingeschüchtert. Frauen werden allein gelassen. Es wird ihnen durch das geburtshilfliche Personal Angst gemacht, dass sie oder ihr Kind sterben werden, wenn sie nicht in Interventionen einwilligen, obwohl diese in den allermeisten Fällen gar nicht notwendig sind. Jedoch spülen diese Geld in die Kasse der Klinik. Es wird gezielt mit Fehlinformationen und Manipulationen gearbeitet.
Zur körperlichen Gewalt gehört, dass Frauen während der Geburt festgeschnallt und fixiert werden, medizinisch nicht notwendige Dammschnitte und Kaiserschnitte durchgeführt werden, die meist falsche Anwendung des Kristellerhandgriffs, Dehnung des Muttermundes mit den Fingern, das Herausreißen der Plazenta. Es werden unter Vorspielung falscher Tatsachen Medikamente verabreicht. Es werden unnötig große Schnittführungen durchgeführt und Schnitte zu eng vernäht. Frauen werden über Interventionen nicht aufgeklärt und ihr Einverständnis wird in sehr vielen Fällen gar nicht erst eingeholt. Es wird sich über die Rechte und die Selbstbestimmung von Frauen hinweggesetzt. Bekanntermaßen sind natürliche Geburten für Kliniken ein Minusgeschäft, hingegen belohnen die Krankenkassen eben jene genannten Interventionen während der Geburt. Zudem führt eine Intervention unweigerlich zu weiteren Eingriffen.
Betroffene Frauen sprechen selber dabei von dem im englischsprachigen Raum längst etablierten Begriff „Birth Rape“. Die Parallelen zu einer Vergewaltigung sind durch gewalttätige Handlungen und Verletzungen gegen Frauen und ihre Geschlechtsorgane, Sprache und einer fehlenden Strafverfolgung offensichtlich. An dieser Stelle verweise ich auf den Blog-Artikel: Birth Rape: Vergewaltigung im Kreißsaal (Mundlos 2018).
Die Gründe für Gewalt unter der Geburt sind: Finanzielle Anreize durch die Krankenkassen um möglichst viele Interventionen durchzuführen, Überlastung des geburtshilflichen Personals – vor allem, da eine Hebamme teilweise 5 -6 Geburten gleichzeitig betreut, patriarchale Strukturen und sadistische Grundeinstellungen des geburtshilflichen Personals.
Zahlen Zahlen Zahlen
Christina Mundlos schätzt, dass mindestens 40 – 50% aller Geburten von Gewalt betroffen sind – dies ist ableitbar aus den hohen Interventionszahlen, die medizinisch nicht nötig sind und über der Grenze der Empfehlungen der WHO liegen. Das Risiko Gewalt unter der Geburt zu erleben liegt bei 1,6 Geburten pro Frau in Deutschland somit bereits bei der ersten Geburt bei ca. 80%. Dabei handelt es sich um Eingriffe, die erwiesener Maßen medizinisch nicht nötig sind und aus finanziellen, strukturell bedingten und psychischen Motiven heraus durchgeführt werden. Die Dunkelziffer der psychischen und physischen Gewalt wird deutlich höher sein, wobei die psychische Gewalt auf Grund fehlender Studien noch gar nicht berücksichtigt ist.
Höchst problematisch ist die Tatsache, dass Geburten unter Nutzung aller medizinischen Möglichkeiten möglichst unter 720 Minuten liegen müssen und vor Ende der Tagschicht und vor dem Wochenende beendet sein müssen. Personal kostet am Wochenende und in der Nacht mehr als tagsüber an Werktagen. Rücksicht auf Frauen und Babys wird dabei nicht genommen.
Die Folgen einer traumatischen Geburt sind verheerend für Mutter und Kind: Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Traumata, Verletzungen oder eine gestörte Mutter-Kind-Bindung um nur einige Beispiele zu nennen.
Wo sind die Partner?
Frauen sind meist dem übergriffigen und gewalttätigen Verhalten des geburtshilflichen Personals ohnmächtig ausgeliefert. Selbst gut vorbereitete und für die Problematik sensibilisierte Schwangere sind Opfer der Gewalt unter der Geburt.
Daher muss berechtigterweise die Frage gestellt werden, wo denn eigentlich die Väter sind und wieso sie sich nicht schützend zwischen ihre Partnerin und dem gewalttätigen Klinikpersonal stellen, denn bei den allermeisten Geburten sind die Väter bei der Geburt dabei.
Und es stellt sich generell die Frage, wo die Väter in der öffentlichen Debatte für eine gewaltfreie Geburtshilfe sind.
Schwangere alleine auf weiter Flur
Das Problem beginnt bereits während der Schwangerschaft: Während sich Schwangere rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Baby informieren und vorbereiten, sind werdende Väter meist nach der Geburt noch genauso schlau wie vorher. Selbst die Kliniktasche wird meist für den werdenden Vater von der Schwangeren gepackt. Viele Männer interessieren sich nicht oder zu wenig für ihre Rolle als Vater und lassen damit die Partnerin alleine. Vom Thema Elternzeit ganz zu schweigen. Dieses Problem zieht sich von der Planung der Schwangerschaft über die Geburt bis zur Kindererziehung. Die Verantwortung für die Kinder wird auf die Mütter übertragen.
Ein „männliches“ Problem
Dieser Umstand ist der männlichen Sozialisation geschuldet und dem damit einhergehenden Männer- und Frauenbild. Dabei geht die Arbeit rund um das Baby eng einher mit dem ohnehin traditionell zugeschriebenen Rollenverständnis, dass Frauen für die Care-Arbeit und die Kindererziehung zuständig sind und Männer für die Erwerbstätigkeit.
Unter der Geburt
Es ist ein Problem, dass Männer, die ansonsten permanent die Führung und Kontrolle innehaben wollen, ihre partnerschaftliche Verantwortung an der Kreißsaaltür abgeben.
Männer lernen sehr früh in ihrer Sozialisation, dass es „Männerthemen“ und „Frauenthemen“ gibt. Männlichkeit wird durch die Abgrenzung zu Weiblichkeit definiert und durch männliche Privilegien. Unter der Geburt übertragen gerade Männer letztendlich die Verantwortung auf Hebammen, die sich ja mit „Frauenthemen“ auskennen müssen und männliche Ärzte – und überlassen damit die Partnerin und das Baby schutzlos den Tätern anstatt selber Verantwortung zu übernehmen.
Es wird sich dem weißen Kittel und der Annahme, dass geburtshilfliches Personal ja am besten wüsste, was für die Mutter das Richtige ist, untergeordnet. Dass dabei auf die Wünsche, Bedürfnisse und Rechte von Frauen keine Rücksicht genommen wird, reiht sich leider ein das frauenfeindliche Denken, dass Frauen über sich und über ihren Körper nicht bestimmen können oder dürfen und dieses anderen überlassen müssen.
Nach der Geburt
Viele betroffene Frauen von Gewalt unter der Geburt sind nach dem schrecklichen Erlebnis traumatisiert. Sie suchen Hilfe bei dem Partner und Vater des Kindes. Doch gerade Männer wollen über das Erlebte nicht sprechen und lassen die Betroffene mit ihren seelischen und körperlichen Verletzungen allein.
Der Grund dafür ist, dass sie sich schuldig fühlen, nicht für sie dagewesen zu sein, wo sie sie am dringendsten benötigt hätte.
Doch ist es ein wichtiger Schritt der Aufarbeitung, sich die Schuld einzugestehen. Gerade Männer haben jedoch damit ein Problem, da es eben nicht zur männlichen starken Beschützerrolle passt, die eigene Partnerin den Gewalttätern schutzlos ausgeliefert gelassen zu haben und danebengestanden und nicht gehandelt zu haben.
„Aber auch Männer schieben doch mal den Kinderwagen..“
Ja, Männer schieben auch mal den Kinderwagen und nehmen ihr Kind auf den Arm, vor allem, wenn Zuschauer dabei sind. Dafür werden sie dann auch gefeiert. Dabei dürfen sie nur nicht allzu „weiblich“ aussehen. Wickeln, Flasche geben, zu jeder Tages- und Nachtzeit aufstehen und sich um das Baby kümmern, all das passt eben nicht in das stereotype Bild des „typischen“ Mannes. Dieser geht lieber arbeiten und anschließend noch mit Freunden einen trinken, anstatt sich während der Elternzeit um das Baby zu kümmern, im überfüllten Wartezimmer des Kinderarztes/der Kinderärztin zu sitzen, sich anspucken zu lassen oder stundenlang mit dem Baby zu spielen. Fürsorglichkeit, liebevoller Umgang, Kindererziehung, Tag und Nacht auf den Beinen zu sein um für das Kind da zu sein, das steht im Widerspruch zur männlichen Dominanzkultur. Zudem verbringen Väter viel weniger Zeit mit ihren Kindern als Mütter.
„Männlichen“ Stereotype müssen aufgebrochen werden. Väter müssen sich selbst in die Pflicht nehmen, Verantwortung für ihre Kinder zu tragen – vor, während und nach der Schwangerschaft. Dabei ist es nicht die Aufgabe der Mütter, Männer für die Schwangerschaft, Geburt und die Kindererziehung zu aktivieren und zu motivieren. Es liegt in der Verantwortung der Väter, diese Aufgabe selbstverantwortlich zu übernehmen. Auch werdende Mütter müssen sich aktiv mit all den auf die zukommenden Aufgaben und Verantwortungen auseinandersetzen. Dies können Väter ebenso.
Gemeinsam klären, was der Partnerin wichtig ist
Für die anstehende Geburt ist es daher sinnvoll, sich mit der Thematik „Gewalt unter der Geburt“ zu beschäftigen. Der erste Schritt für den werdenden Vater besteht darin, sensibel dafür zu werden, welche Formen der Gewalt die Partnerin im Kreißsaal erwarten kann. Klar ist aber auch, dass Gewalt unter der Geburt eventuell nicht verhindert werden kann, dass das Risiko aber durch gut vorbereitete und aktive Väter (sowie das Hinzuziehen einer Doula) stark gesenkt werden kann.
Wichtig ist es miteinander darüber zu sprechen und vorab zu klären, was die Partnerin unter der Geburt möchte und was sie nicht möchte und wie der Partner auf gewalttätige Übergriffe reagieren soll.
Wichtig ist, sich über mögliche Interventionen und deren Konsequenzen zu informieren. Der werdende Vater sollte absprechen, bei welchen geplanten Interventionen eingegriffen werden soll oder welche Alternativen existieren um diese dann gezielt anzusprechen und geplante Interventionen zu hinterfragen. Es geht vor allem darum, die Partnerin in ihrer Selbstbestimmtheit zu stärken und Eingriffe von außen möglichst zu vermeiden. Die Bedingungen der Partnerin sollten vor der Geburt klar definiert und schriftlich festgehalten werden. Es kann im Vorfeld mit der Nachsorgehebamme über das Thema gesprochen werden.
Über den Besuch eines Vorbereitungskurses kann nachgedacht werden – vom Hypnobirthing bis zur achtsamen Geburtsvorbereitung.
Es sollte darüber nachgedacht werden, ob nicht eine außerklinische Geburt infrage kommt. Die Zahl von Interventionen beispielsweise in Geburtshäusern ist verschwindend gering. Sollte die Wahl jedoch auf eine Klinik fallen, dann ist der Besuch beim Informationsabend wichtig. Dort können Fragen zu den Kaiserschnittraten, Dammschnittraten, der Möglichkeit der Badewannennutzung oder beispielsweise ob auch alternative Gebärpositionen möglich sind, gestellt werden.
Aktives und weitsichtiges Handeln ist gefragt, gute Vorbereitung und ein starkes Standing.
Der werdende Vater sollte sich der eigenen Rolle und Verantwortung bewusst werden um dementsprechend während der Geburt handlungsfähig zu sein und – zu bleiben.
Auch sollte über das Hinzuziehen einer Doula nachgedacht werden, die in einer 1:1-Betreuung für Frauen da ist, sie während der Geburt unterstützt und sie begleitet.
Eine gute Vorbereitung ist zudem wichtig, da Väter oft als sogenannte Second Victim bei Gewalt unter der Geburt indirekt betroffen und werden oft mittraumatisiert sind. Infolgedessen leiden sie oft an Schuldgefühlen. Dies kann dazu führen, dass sie die Mutter nicht mehr adäquat unterstützen und mit ihr traumasensibel umgehen können.
Durch eine gute Vorbereitung kann das Risiko Gewalt unter der Geburt zu erleben gesenkt werden, aber auch dass Väter selbst traumatisiert werden.
Sollte trotz aller Bemühungen der Partnerin Gewalt unter der Geburt widerfahren sein, so hat es nichts mit Schwäche zu tun, sich dies einzugestehen. Sprecht darüber, seid füreinander da und durchlebt die Zeit gemeinsam.
Was Väter noch tun können
In der öffentlichen Debatte sind fast ausschließlich Frauen zu finden. Dies lässt patriarchale Strukturen deutlich sichtbar werden. Gewalt unter der Geburt ist eng verknüpft mit frauenverachtendem und antifeministischem Denken.
Daher ist es wichtig, dass auch Männer in die Öffentlichkeit treten und den Kampf auf politischer Ebene führen. Solange davon ausgegangen wird, dass der Beginn jeden Lebens ein reines „Frauenthema“ ist und sich die Väter, aber auch alle anderen Menschen daran nicht beteiligen, so lange werden Frauen diesen Kampf allein führen. Viel effizienter wäre es hingegen, wenn dieser Weg gemeinsam gegangen wird und die Täter, PolitikerInnen und alle Beteiligten spüren, dass sie diese Form der Gewalt/ der Straftaten nicht mehr begehen können. Wenn eine breite öffentliche Meinung gegen Gewalt unter der Geburt existiert und der Druck, mögliche Sanktionierungen und rechtliche Maßnahmen zunehmen, dann wird es den Tätern schwer gemacht, Straftaten im Kreißsaal zu begehen.
Was von Vätern außerdem getan werden kann:
- Das Buch „Gewalt unter der Geburt“ von Christina Mundlos lesen und anderen Schwangeren schenken, sowie das Lesen ihrer-Blogseite,
- das Thema „Gewalt unter der Geburt“ kann in Geburtsvorbereitungskursen thematisiert werden,
- für die Mutter da sein, sie unterstützen, ihr zuhören, sie massieren etc.,
- sich um das Baby kümmern,
- soziale Netzwerke und speziell Gruppen zu dem Thema können genutzt werden (zB. bei Facebook zum Thema von Christina Mundlos),
- Väter können sich vernetzen,
- politisch aktiv werden
- am Roses Revolution Day (25.11. zeitgleich mit dem „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“) können auch Väter eine Rose und einen Brief vor der Kreißsaaltür ablegen, hinter der der Partnerin Gewalt angetan wurde.
- die Betroffene unterstützen, wenn sie eine Anzeige über die Straftat, die ihr im Kreißsaal angetan wurde, stellen möchte,
- es können laufende Petitionen zu dem Thema unterstützt oder eigene eingereicht werden,
- Kliniken können beispielsweise an Infoabenden gezielt auf das Thema Gewalt unter der Geburt angesprochen werden,
- BloggerInnen können über das Thema schreiben,
- LokalpolitikerInnen können befragt und angeschrieben werden,
- traumatisierte Väter können sich therapeutische Hilfe holen.
Appell an die Väter
Liebe Väter, es geht um eure Partnerin und eure Kinder. Ihr seid eine der Wenigen, die sie in diesem intimen und wehrlosen Moment beschützen können. Ihr seid für eure Partnerin und für euer Baby mitverantwortlich. Übernehmt diese Verantwortung, werdet aktiv, lasst eure Partnerin diesen Weg nicht allein gehen: informiert euch („Gewalt unter der Geburt“ von Christina Mundlos), bereitet euch vor, tauscht euch aus, sprecht über Eventualitäten, sprecht über das, was eure Partnerin möchte und was sie nicht möchte, sprecht über mögliche Reaktionsmöglichkeiten, über eine mögliche außerklinische Geburt und das Hinzuziehen einer Doula.
Christina Mundlos: Gewalt unter der Geburt. Auf das Foto klicken, um das Buch auf Amazon anzusehen.